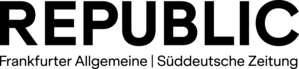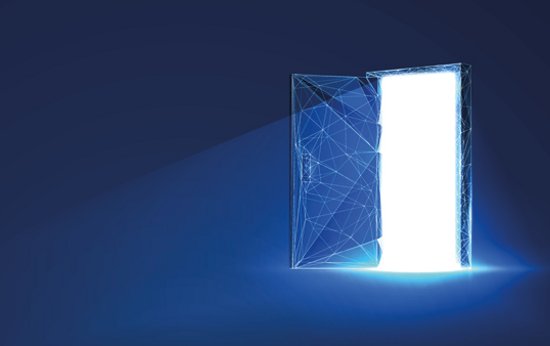Wissen schafft Vertrauen
Die Rolle von Wissenschaftsjournalismus am Beispiel des Klimawandels.
Von Sibylle Anderl
Wer Krisen bewältigen will, braucht fundiertes Wissen – das hat uns nicht zuletzt die Pandemie gelehrt. Nur wer die uns bevorstehenden Herausforderungen kennt und versteht, und nur wer eine Vorstellung über mögliche Lösungsoptionen, deren Risiken und Potenziale besitzt, kann Zukunft erfolgreich mitgestalten. Das gilt mindestens genauso für den Klimawandel, der – anders als die Pandemie – in unserem Alltag weniger dringlich erscheint und daher medial leicht in den Hintergrund gedrängt wird.
Solches Wissen wird zum großen Teil in Forschungsinstituten geschaffen. Von dort muss es in die Öffentlichkeit gebracht werden. Die Wissenschaftler können das nicht selbst tun. Kommunikation ist nur in den seltensten Fällen ihre Expertise, als Spezialisten fehlt ihnen oft der interdisziplinäre Blick für das große Ganze, und außerdem sollte der Transfer des Wissens von einer unabhängigen und kritischen Instanz geleistet werden. Die Kommunikation krisenrelevanten wissenschaftlichen Wissens in die Öffentlichkeit braucht qualitativ hochwertigen Wissenschaftsjournalismus.
Zusätzlich braucht der Transfer aber noch etwas anderes, wenn er gelingen soll: Vertrauen. Vertrauen in die Wissenschaft und Vertrauen in den Wissenschaftsjournalismus. Beides hängt zusammen, und beides wurde in der Pandemie bereits stark auf die Probe gestellt. Das liegt einerseits daran, dass die kommunizierten Botschaften nicht immer angenehm sind. Eine Strategie auf Seiten der Empfänger, das Unangenehme zu meiden, ist, ihm die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Vertrauensverlust kann andererseits aber auch daran liegen, dass es gerade in Krisenzeiten Akteure gibt, deren Interessen durch wissenschaftlich erlangtes Wissen bedroht sind – und die deshalb versuchen, in gezielten Kampagnen Zweifel zu säen.
Historisch ist das hinreichend belegt an Episoden wie der Diskussion, ob Rauchen krebserregend ist, oder ob wir Menschen an saurem Regen oder dem Ozonloch schuld waren. Heute wird diese Strategie in gleicher Form angewendet, wenn es darum geht, Zweifel am menschengemachten Klimawandel zu säen.
Diese immer wieder in politischen und ökonomischen Kontexten auszumachende Strategie ist deshalb so erfolgreich, weil ihr eine Asymmetrie zugrunde liegt: Es ist sehr viel einfacher, Zweifel zu säen, als komplexe Probleme und Methoden zu erklären. Auf der Strecke bleibt das Vertrauen. Wenn es um ein so großes und zukunftsentscheidendes Problem wie den Klimawandel geht, steht dadurch zugunsten kurzsichtiger Profit- und Machtüberlegungen unsere zukünftige Existenz auf dem Spiel.
Was kann der Wissenschaftsjournalismus dagegen tun? Er muss geduldig und ohne jede Spur von Arroganz erklären, wie Wissenschaft funktioniert, was wir wissen und was wir nicht wissen. Er muss dabei als vertrauenswürdiger Vermittler auftreten: Er sollte immer kritisch sein, und das bedeutet, dass er selbst ein hohes Maß von Verständnis für wissenschaftliche Methodik braucht. Er muss auch transparent in Bezug auf Unsicherheiten und den Umgang mit ihnen sein. Dazu gehört, sich in seinen eigenen Vorurteilen und Voreingenommenheiten immer auch kritisch selbst zu hinterfragen. Die Umsetzung solch hochwertigen Wissenschaftsjournalismus ist im hektischen und Klickzahl-getriebenen Tagesgeschäft alles andere als einfach. Sie ist aber zentral wichtig, denn letztendlich ist sie Grundlage für den funktionierenden demokratischen Umgang mit der größten Krise, die die Menschheit in ihrer globalen Gesamtheit erlebt hat.

Sibylle Anderl
Seit 2021 Leiterin des Wissenschaftsressorts der F.A.Z. und F.A.S. Seit 2010 war die Astrophysikerin für die F.A.Z. als freie Autorin und danach als Redakteurin im Ressort „Natur und Wissenschaft“ tätig. 2019 erhielt sie den Roelin-Preis für Wissenschaftspublizistik.