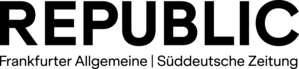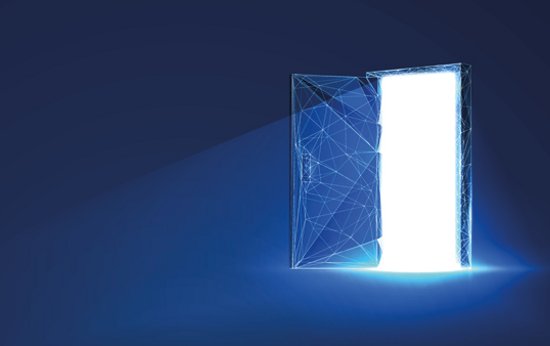Setzt das Netz die Themen?
Über den professionellen Umgang mit den Risiken und Nebenwirkungen von Twitter.
Von Cornelius Pollmer
Was Twitter zu dem besonderen Medium macht, das es trotz Elon Musk vermutlich noch eine Weile bleiben wird, ist seine Ambivalenz. Es kann der allerschönste digitale Ort der Welt sein, an dem sich so überraschend und überwältigend lachen und lernen lässt – und dann wieder die elende Schlammgrube, in der alles Mögliche versinkt, von der allgemeinen Debattenkultur bis zur Würde von Kollegen (m/w/d), vor denen man gerade noch Hochachtung hatte, bevor sie plötzlich anfingen, ihre Eitelkeiten oder Streitgelüste öffentlich mit fremden Kleinstaccounts auszuleben. Viele Journalisten sind und bleiben bei Twitter, weil es der erwähnte schönste Ort ist – und weil sie nunmal dort sind, stellt sich die Frage, was es für journalistische Arbeit und für deren Publikum bedeutet, wenn aus dem Schönen mal wieder die Schlammgrube wird.
Die Effekte von Twitter auf den Journalismus sind dabei so ambivalent wie das Medium selbst. Twitter hat den Journalismus verbessert, weil Menschen sich hier Gehör bei Multiplikatoren verschaffen können, was früher unerreichbar gewesen wäre. Wenn eine Filmsequenz von einer Demo auftaucht, auf der Polizei oder Demonstranten Gewalt ausüben oder wenn sachkundige Bürgerinnen auf Fehler in journalistischen Beiträgen hinweisen möchten: Auf Twitter gewinnen wichtige Wortmeldungen schnell an Höhe, das erhöht die Chance auf Wahrnehmung durch Journalisten und damit die Chance, dass Journalismus besser seine aufklärerischen Aufgaben erfüllen kann.
Twitter hat andererseits dem Journalismus geschadet, weil das Medium noch immer nicht von allen Journalisten souverän genutzt wird. Redaktionen lassen sich manchmal vom digitalen Schein trügen und verleiten, sie stufen dann etwas als wichtig für alle ein, weil es auf Twitter wichtig aussieht, obwohl in Wahrheit nur wieder dieselben drei Dauernervösen sich darüber unterhalten. Manchmal ist es so: Twitter-Trends und Shitstorms bringen Journalisten dazu, über etwas zu berichten. Diese breite Berichterstattung wiederum erzeugt (als sich selbsterfüllende Prophezeiung) eine echte Diskursrelevanz, weswegen neu und weiter über „ES“ berichtet wird. Und „ES“ kann ärgerlichstenfalls eben der größte Unsinn der Welt sein. Ja, es kann dann wirklich vorkommen, dass die Frage diskutiert wird, ob ein Politiker beim Medientermin im Flutgebiet die richtigen Schuhe anhatte – und ärgerlich ist so etwas vor allem deshalb, weil der zuweilen zutreffende Eindruck entsteht, dass über Wichtiges weniger berichtet werden kann, solange das inkriminierte Schuhwerk vielleicht nicht im modischen Trend liegt, aber in dem von Twitter.
So weit, so puh. Nun ist die ambivalente Diskurskraft von Twitter ja aber da – und damit die implizite Verpflichtung von Journalistinnen und Journalisten, mit ihr irgendwie umzugehen. Eine mögliche Antwort darauf erfordert gar nicht so viel Kreativität. Vielmehr hat der Journalismus in den vergangenen Jahren der Transformation eine Grunderfahrung gemacht, die auch im Umgang mit Twitter hilfreich sein kann. Die Datengrundlagen, mit denen Journalismus arbeitet, haben sich ja überall verbessert. Redaktionen wissen heute sekundengenau, welche Inhalte auf welches Interesse stoßen und genauso kriegen sie auf Twitter viel mehr und schneller Wind von Ereignissen und Meinungen denn je. Wie damit umgehen? In beiden Fällen wohl besser so, sich über die vielen neuen Messwerte zu freuen – und gleichzeitig nicht blind nach ihnen zu handeln. Sondern stattdessen selbst dann mal einen Twitter-Trend auszulassen und wegzuschweigen, wenn man ahnt, dass ein Beitrag dazu viel Traffic und damit wenigstens mittelbar auch einen ökonomischen Gewinn bringen dürfte. Solche Entscheidungen souverän zu treffen, ist durchaus eine Frage von Berufsethik und Haltung – und in dieser Weise kann Twitter selbst mit seinen schlechten Eigenschaften am Ende helfen, die Sinne zu schärfen.

Cornelius Pollmer
Von 2013 an berichtete er für die Innenpolitik der SZ aus Dresden und Leipzig, inzwischen gehört er dem Feuilleton an.